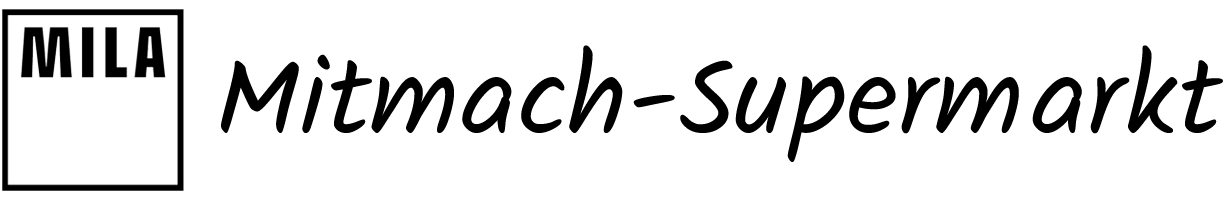Eine Genossenschaft sichert die Nahvorsorgung in der Gemeinde Losenstein
1844 gründeten englische Weber die erste genossenschaftliche Initiative. 1856 folgte im niederösterreichischen Teesdorf der erste österreichische Konsumverein. Bald darauf gab es hunderte solcher Konsumgenossenschaften auf dem Land und in der Stadt. Heute existieren nur mehr wenige. Eine davon ist die 120 Mitglieder starke „UMS EGG – 1. Ennstaler Genossenschaftsgeschäft“ in der oberösterreichischen Gemeinde Losenstein. Der 100 m² große Laden ist für alle an drei Tagen in der Woche geöffnet, Genossenschaftsmitglieder können sieben Tage die Woche und wochentags bis 21.00 Uhr über 1.000 Produkte von zirka 70 Lieferant*innen einkaufen. MILA Gründungsmitglied David Jelinek sprach mit Geschäftsführer Bernd Fischer.

David: Hallo Bernd! Auf eurer Homepage steht „Ennstaler Dorfgenossenschaft“. Was macht ihr genau?
Bernd: Es ist eine Dorfgenossenschaft, die gegründet wurde, um Infrastruktur zu erhalten, regional wirtschaften zu können und um ein Stück weit unabhängig zu sein – von einem Großhändler der uns beliefert. So haben wir die Freiheit, möglichst regional einzukaufen. Deswegen ist es auch eine duale Genossenschaft mit Produzent*innen und Konsument*innen. Damit können beide Seiten auf Augenhöhe verhandeln.
In der Genossenschaft gibt es drei Kurien: die der Produzent*innen und Lieferant*innen, die aller Kund*innen und eine dritte, die darauf schaut, dass die Idee nicht verwässert wird, die „Hüter*innen“ der Idee. So sind wir prinzipiell aufgebaut, dass das Geschäft den Nutznießer*innen gehört, sowohl den Produzent*innen als auch den Kund*innen.
D: Bedeutet das, dass alle eure Lieferant*innen auch Genossenschafter*innen sind?
B: Nein, das beruht auf Freiwilligkeit. Nicht alle unsere Lieferant*innen und auch nicht alle unsere Kund*innen sind Teil der Genossenschaft. Man kann auch als Kundin und Kunde an drei Öffnungstagen einkaufen, ohne Mitglied zu sein. Man kann auch liefern, ohne Genossenschaftsmitglied zu sein. Da wo es Sinn macht, z.B. beim Gemüse, arbeiten wir auf Kommission. Wenn die Lieferant*innen auch Genossenschaftsmitglieder sind, haben sie Einblick in die Zahlen, sehen wie viel Verderb abgebucht wurde usw. Das ist für uns auch ein Vorteil, da wir den Verderb nicht als Risiko abbuchen müssen, und die Lieferant*innen haben den Vorteil, da es auch in ihrem Interesse ist, dass gut gewirtschaftet wird. Das beruht alles auf einem Vertrauensverhältnis, welches uns sehr viel Hin und Her-Rechnen erspart.
D: Hier ergibt sich sicher das eine oder andere Spannungsfeld durch unterschiedliche Interessen. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht, dass bei euch die Sichtweisen oder Wünsche von Konsument*innen und Produzent*innen aufeinander stoßen? Gab es da schon Diskussionen bei euren Versammlungen?
B: Ja klar! Ich kann mich an unsere erste Generalversammlung erinnern. Eines der Themen waren Kosten: Wie lassen sich Kosten sparen, wo können wir da ansetzen? Da kam die Anfrage eines Kunden, der meinte, ihm sei klar, dass wir den Aufschlag auf die Produkte nicht verringern können, denn das wäre auch kontraproduktiv für die Kostendeckung, aber vielleicht könnten ja die Lieferanten für ein Jahr von ihrem Preis zurück steigen? Ich musste gar nichts dazu sagen, da drei Bauern im Raum waren, die gleich ganz bleich wurden. Daraus ergab sich eine spannende Diskussion.
Es ist so: Wir machen ja wirklich einen so genannten „Game Changer“, da muss man vieles erklären. Vielen ist in dieser Dimension gar nicht bewusst, was das alles heißt. Ein Beispiel: Wir dachten uns, es sei ein gutes Argument zu sagen „über 60 Prozent des Verkaufspreises kriegt der/die Produzent*in“. Das ist dreimal so viel wie im durchschnittlichen Lebensmittelhandel. Die Kundin und der Kunde sagt: „Naja, muss ja nicht dreimal so viel sein, vielleicht genügt auch zweimal so viel.“ Wobei man natürlich die ganzen Mengeneffekte weglässt. Es ist ja nicht so, dass der dann dreimal so viel verdient. Und das sind dann Diskussionen mit vielen Aha-Effekten auf beiden Seiten. Daran sieht man, dass es mit diesen einfachen Rechnungen nicht funktioniert, dass du das erklären musst.
D: Eine Verständnisfrage: Ihr habt die Genossenschaft gegründet, das heißt, ihr habt sowohl Lieferant*innen als auch Konsument*innen in der Genossenschaft, und Leute, die du als die „Hüter*innen der Idee“ beschrieben hast… Welchen Vorteil habe ich nun als Genossenschaftsmitglied gegenüber einer „normalen“ Kundschaft?
B: Die erweiterten Öffnungszeiten. Für normale Kund*innen sind diese Dienstagvormittag, Freitagnachmittag, Samstagvormittag. Wir haben da eine Angestellte, die führt diesen Laden. Als Genossenschaftsmitglied kann ich sieben Tage die Woche rein, weil es ein Selbstbedienungskonzept ist. Wir brauchen da ein anderes Konzept, weil wir haben keine 7.000 Mitglieder wie La Louve in Paris. Wir haben 1.600 Einwohner*innen, das geht sich nicht aus. (lacht) Das heißt, es braucht ein anderes wirtschaftliches Grundkonzept und das geht in dem Fall nur über die Selbstbedienung. Du kannst es natürlich über Rabattschlachten oder Vorteile für die Mitglieder versuchen, aber dahin wollen wir gar nicht.
D: Ihr seid damit auch flexibel und sehr am Puls der Zeit mit diesem Konzept, um zu zeigen, wie man die Leute auch mit an Bord bekommen kann.
B: Unser Modell passt auch perfekt zur Pandemie. Viele genießen es, alleine einzukaufen. Man kommt rein, das Licht geht an und der Laden gehört dir. Man kann sich alles in Ruhe durchlesen. Es gibt auch Mitglieder, die es lieben, Freund*innen und Verwandte einzuladen, um ihnen eine Tour durch „ihr“ Geschäft zu geben. Die machen da richtige Sonntagstouren mit Besuch aus Wien oder den Enkeln und sind so stolz drauf, dass sie so einen modernen Laden haben, wo die Besucher*innen aus Wien zugeben müssen: „Boah, so was haben wir noch nicht einmal!“

D: Das bedeutet, euer Konzept lautet nicht, dass die Mitglieder alle vier Wochen drei Stunden mitarbeiten?
B: Nein, das geht sich bei uns nicht aus.
D: Genau, aber du hast vorher von Freiwilligkeit gesprochen. Ihr habt einfach Genossenschaftsmitglieder, die interessiert sind und Lust haben, auch mehr zu machen. Aber angestellt bist du neben einer zweiten Person?
B: Derzeit sind es drei, ansonsten zwei, die geringfügig angestellt sind als Verkäuferinnen für die Öffnungszeiten. In der Bauphase wurden hunderte Stunden reingesteckt, vor allem von Männern. Jetzt ist es genau umgekehrt: Es sind ganz viele Frauen, die sich engagieren. Wir haben auch mit einem kleinen Team angefangen und jetzt können wir uns schon auf 12 Gruppen aufteilen, die bestimmte Bereiche abdecken. Jetzt haben wir den Luxus mittlerweile, dass wir Neue fragen können, was ihre Stärke ist und wo sie sich gerne einbringen wollen.
D: Zurück zum Thema Genossenschaft: War für euch oder für dich von Anfang an klar, dass dies die einzige Rechtsform ist, mit der ihr das angehen wollt?
B: Ja, ich habe das Geschäft davor fünf Jahre als selbständiger Kaufmann geführt. Mit ganz viel Lob, wie toll das ist und wie regional und innovativ. Aber nachts habe ich immer alleine meine Geldsorgen gewälzt. Und nachdem ich zugesperrt habe, war für mich klar, wenn ich in dieser Branche noch einmal was mache, dann muss das auf viele Schultern verteilt werden. Und da ist die Genossenschaft die Idealform, da das Solidaritätsprinzip viel klarer durchgezogen ist: Jeder weiß wie hoch seine Haftung ist. Und bei der Größenordnung, die wir hier haben, geht es doch um sechsstellige Beträge.
D: Da kannst du auch ruhig schlafen am Abend.
B: Wenn ich nicht ruhig schlafe, dann schreibe ich einen Brief an alle Mitglieder. Dann schlafen vielleicht 20 Leute schlecht, aber jeder nur ein bisschen. Wir hatten das ja kurz im September, da habe ich den Vorstand informiert, dass, wenn es so weitergeht, wir bald zusperren müssen. Dann gab‘s eine Sondersitzung, und innerhalb einer Woche haben dann 120 Leute schlecht geschlafen. Aber es hat sich anders angefühlt. Es war total beruhigend zu wissen, jetzt machen sich 120 Leute Gedanken. Was für ein Potential, was für eine Kreativität – das Wissen ist ja nicht in einem Hirn alleine, es ist verteilt.
Es war dann eine große Anstrengung, mit allen Mitgliedern zu sprechen, aber auch ein Geschenk. Für mich hat in dem Moment die Genossenschaft begonnen, wirklich zu leben. Eine Frau meinte dann: „Verkauf interessiert mich nicht, aber ich bin Buchhalterin, ich kann ja ein paar Stunden im Monat in der Buchhaltung helfen.“ Und da hab ich mir gedacht „Wow, wo kommt dieser Engel her?“
Für mich ist das auch ein Lernprozess. Ich war vorher der Selbständige, der jede Idee einfach umsetzte. Jetzt haben alle plötzlich Ideen, und bei manchen denkst du dir: Idealistisch –ja! Wirtschaftlich – nein! Aber ich kann natürlich nicht drüber fahren, weil das sind ja keine Angestellten, sondern Freiwillige, die es sich auch jeden Tag wieder anders überlegen können. Diese Freiwilligkeit erfordert auch viel mehr Achtsamkeit von mir im Umgang mit Macht. Ich muss die Leute viel mehr mit ins Boot holen, muss viel mehr argumentieren, mir mehr Zeit nehmen. Aber das ist mir auch wichtig, weil wir auch in einer Situation sind, die nicht so einfach ist.
D: Eine Frage, die ich noch interessant finde: Wie seid ihr bei der Sortimentsgestaltung vorgegangen? Habt ihr da bereits viel gemeinsam gemacht oder hast du mit deiner Vorerfahrung einfach gesagt: „Das ist das Sortiment!“
B: Nein, ich habe eine Vorauswahl getroffen, indem ich die Regale in jeder Kategorie in etwa ein Drittel leer gelassen habe. Also so, dass ein Grundsortiment da war. Denn wenn du das alles demokratisch lösen willst – viel Spaß! Wir haben tausend Produkte, tausend Entscheidungen, da brauchst du hundert Jahre.
Außerdem war das ja nur der Start, das war ja nicht in Stein gemeißelt und heißt auch nicht, dass die Produkte, die ich am Anfang ausgewählt habe, heute noch im Geschäft sind. Weil das ist der erste Punkt: Wenn ich sehe, die funktionieren nicht, werden nicht gekauft, das ist schon mal Basisdemokratie. Da entscheidet jeder sehr direkt mit, ob was drin bleibt oder nicht.
Dann müssen die Leute, wenn sie in den Laden kommen, das Gefühl haben, dass alles da ist, dass sie die wichtigsten Grundbedürfnisse stillen können. Dann gibt es eine öffentliche Tafel, wo alle ihre Wünsche äußern können, was sie gerne im Sortiment hätten. So haben wir sicher 200-300 Produkte ins Sortiment genommen, wo jemand dahinter steht und der Botschafter dieses Produktes ist. Wenn es sich nicht verkauft, fliegt es raus. Also ist diese eine Person bemüht, das Produkt zu verkaufen.
D: Klingt wie gelebte Konsumdemokratie!
B: Ein anderes Beispiel sind Bananen. Es gibt ja auch die Meinung: Wir brauchen keine Bananen, das hat ja mit Regionalität nichts zu tun. Aber 80 Prozent der Leute sehen das anders. Daher gibt‘s die Bananen.
D: Eine letzte Frage: Was gibst du uns mit auf den Weg?
B: Hmmmm. Erfahrungen sind immer die Summe vieler kleiner Fehler. Fehlerfreundliche kleine Gemeinschaften sind die Zukunft, habe ich mal wo gelesen. Sich auf die Fehler freuen, das lässt uns dann auch experimentierfreudig bleiben. Mit dieser Grundhaltung braucht ihr keine Angst haben! Wir arbeiten an einem Kernbereich der Gesellschaft. Es geht um Grundversorgung. Es geht um wirklich wichtige Themen, die Schlüsselthemen sind für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Und das ist befriedigend.